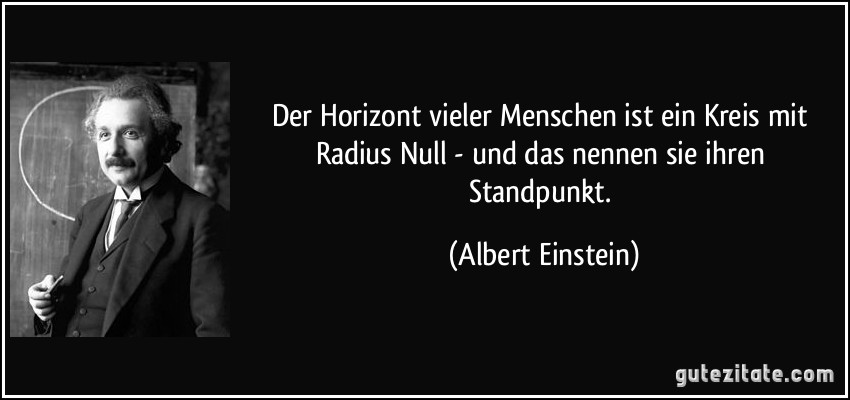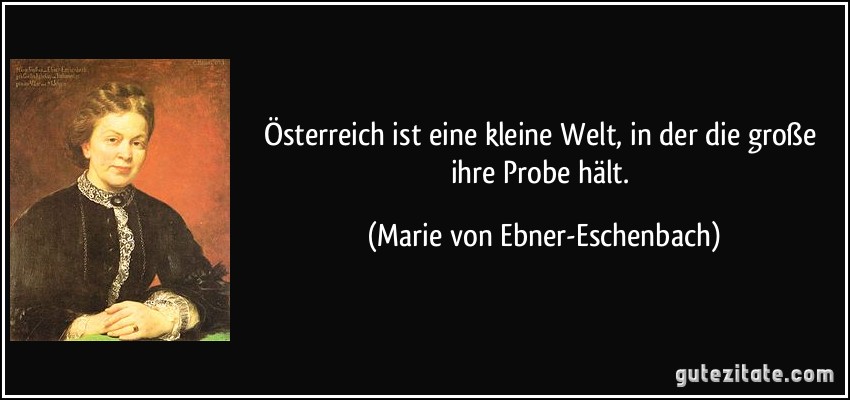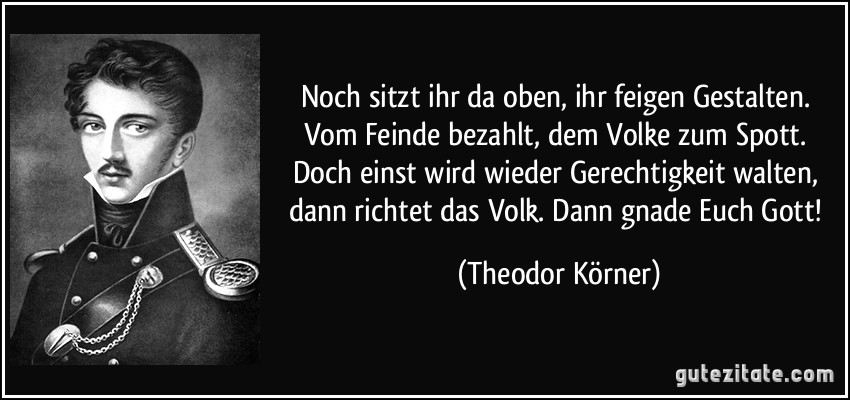|
| Entstelltes Einstein-Zitat. |
Aus dem ursprünglichen Satz von Albert Einstein, "Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle", wurde die pathetische Aussage, "Das tiefste und erhabenste Gefühl, dessen wir fähig sind, ist das Erlebnis des Mystischen".
Ursprünglich lautet der Satz von Albert Einstein in "Wie ich die Welt sehe", 1931:
- "Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen."
Albert Einstein: Mein Weltbild. Hrsg. von Carl Seelig. Europa Verlag, Zürich Wien: 1953, S. 10 (Link)Erstdruck (nach Carl Seelig): "Forum and Century," vol. 84, pp. 193-194; Living Philosophies, Bd. 13, New York 1931
- "The fairest thing we can experience is the mysterious. It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science. He who knows it not and can no longer wonder, no longer feel amazement, is as good as dead, a snuffed-out candle. It was the experience of mystery—even if mixed with fear—that engendered religion."
Albert Einstein, Übersetzung von Alan Harris, 1931 (Link)
- "The most beautiful experience we can have is the mysterious.It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science. Whoever does not know it and can no longer wonder, no longer marvel is as good as dead, and his eyes are dimmed."
Albert Einstein, Übersetzung von Sonja Bargmann, 1954
Albert Einstein: Ideas and Opinions, based on Mein Weltbild, hrsg. von Carl Seelig, Bonzana Books, New York: 1954
Youtube 3:05
- "Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder."
Albert Einstein: Mein Glaubensbekenntnis 1932 (Link)
___________
Quellen:
Hans-Josef Küpper: Einstein's Credo, mit einer Transkription des Manuskripts, Einstein-Website.de, 2000-2016, (Link)
Albert Einstein: "Mein Glaubensbekenntnis", Schellackplatte, September/Oktober 1932: Youtube (Link)
Albert Einstein: Ideas and Opinions, based on Mein Weltbild, hrsg. von Carl Seelig, Bonzana Books, New York: 1954, S. 11
Albert Einstein: Mein Weltbild. Hrsg. von Carl Seelig. Europa Verlag, Zürich Wien: 1953, S. 10 (Link)
Albert Einstein: "Wie ich die Welt sehe" Erstdruck (nach Carl Seelig): "Forum and Century," vol. 84, pp. 193-194; Living Philosophies, Bd. 13, New York 1931
(Datierungen müssen noch überprüft werden.)
Juttas Zitateblog: "Über Einsteins Worte 'Wer sich nicht mehr wundern und in Ehrfurcht verlieren kann, ist seelisch bereits tot'", 2011 (Link)
________
Dank:
Die Dokumentation auf Juttas Zitateblog war sehr hilfreich.
__________
Artikel in Arbeit.